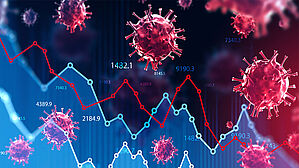
Wer in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis steht und nicht in Kurzarbeit geschickt wurde, merkt wirtschaftlich wenig von der Krise. Freilich, Einschränkungen gibt es für uns alle und zeitweise gehen diese gerade für Familien mit Kindern an die Grenze des Erträglichen. Allerdings waren wir bislang anders als unsere französischen, spanischen und italienischen Nachbarn nicht von Maßnahmen wie Ausgangsverboten betroffen.
Abhängig Beschäftigte leiden tatsächlich in der Regel deutlich weniger von wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise als viele Selbstständige mit kleinen Betrieben oder Solo-Selbständige. Nicht unterschätzen dürfen wir aber die Auswirkungen, die die Pandemie auf unsere Position als abhängig Beschäftigte gegenüber der Arbeitgeberseite hat. Die ist nämlich umso stärker, je knapper die „Ware Arbeitskraft“ ist. Wenn mehr Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt vorhanden ist als das Angebot an Arbeitskräften, sind zudem viel weniger Menschen auf Arbeitslosengeld oder sogar Hartz IV angewiesen.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt sind nach wie vor deutlich sichtbar
Bevor die Pandemie ausgebrochen ist wurde unsere wirtschaftliche Position zunehmend komfortabler: die Arbeitslosigkeit war rückläufig. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg an. Was abnahm war die Zahl der Langzeitarbeitslosen und derjenigen Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind.
Das alles ist gerade einmal ein halbes Jahr her. Jetzt leben wir auch wirtschaftlich wieder in einer anderen Welt.
Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat am 30. September Zahlen präsentiert, die den Arbeitsmarkt betreffen. Daniel Terzenbach, zuständig bei der BA für die Regionen, verkündete vorsichtig optimistisch: „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt sind nach wie vor deutlich sichtbar. Es zeigen sich aber leichte Zeichen der Besserung.“
In der Tat sehen die Zahlen nicht sehr schlecht aus, vergleicht man sie mit denen von März oder April. Die Zahl der Arbeitslosen war im September 2020 um 108.000 niedriger als im August, allerdings um 613.000 höher als im September 2019. Berücksichtigen müssen wir auch, dass es jedes Jahr im September ein Phänomen gibt, das sich „Herbstbelebung“ nennt. Urlaubs-, Ferien- und Sommerpause sind vorbei, die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen steigt. Zudem gibt es die ersten Vorboten des Weihnachtsgeschäfts.
Die Zahl der Neuinfektionen steigt fast überall wieder an
Gemessen daran stimmen die Zahlen nicht unbedingt optimistisch. Hinzu kommt noch, dass viele Maßnahmen wie Überbrückungshilfen für Solo-Selbständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen demnächst vermutlich fortfallen. Zugleich steigt die Zahl der Infektionen wieder fast überall an.
Im September 2020 waren in Deutschland 44,71 Millionen Personen erwerbstätig, das sind Vergleich zum Vorjahr knapp 600.000 weniger. Zugleich ist die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften bereits gleich zu Beginn der Corona-Krise massiv zurückgegangen. Im September waren 591.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, knapp 200.000 weniger als vor einem Jahr. Die Nachfrage an Arbeitskräften hat also um etwa ein Drittel abgenommen.
Mehr als sieben Prozent aller Menschen in Deutschland, die in einem erwerbsfähigen Alter sind, haben keinen Arbeitsplatz, das sind knapp fünf Millionen. Nur etwas mehr als eine Million davon bekommen Arbeitslosengeld. Viermal so viele sind auf Hartz IV angewiesen. Das ist indessen aber nicht allein auf die Pandemie zurückzuführen. Bereits vorher gab es Anzeichen, dass sich die Konjunktur allmählich abschwächt.
Nicht nur die Pandemie sorgt für den Abschwung
So sank die Nachfrage nach Arbeitskräften schon Anfang des Jahres. Auch die Zahl der Beschäftigten, für die Kurzarbeit angeordnet war stieg seit einigen Monaten langsam, aber kontinuierlich an. Viele Menschen waren nur deshalb nicht arbeitslos, weil sie sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen befanden, als Minijobber, Solo-Selbstständige oder in befristeten Arbeitsverhältnissen.
Folgerichtig wird diskutiert, ob es nach Corona ein „Weiter so“ geben darf. Denn eines hat die Krise deutlich gezeigt: der Kapitalismus in seiner heutigen Gestalt reagiert sensibel, wenn es kein wirtschaftliches Wachstum gibt. Wir haben aber ja nicht nur Corona, sondern auch eine Klimakrise, die eigentlich weiteres Wachstum verbietet, jedenfalls wenn es um die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und um weitere Belastung der Umwelt mit Treibhausgasen geht. Eine weitere - nicht sonderlich überraschende - Erkenntnis ist, dass unter den wirtschaftlichen Folgen von Krisen diejenigen am meisten leiden, die ohnehin schon wenig haben.
Auf der anderen Seite werden Superreiche nicht nur trotz sondern auch durch die Pandemie immer reicher. Das Gesamtvermögen der mehr als 2000 Dollarmilliardäre weltweit stieg bis Ende Juli auch dank der Erholung an den Aktienmärkten auf den Rekordwert von rund 8,7 Billionen Euro, wie die Beratungsgesellschaft PWC und die Schweizer Großbank UBS errechnet haben.
Ein „Weiter so“ mit Turbo-Kapitalismus und ungebremstem Wachstum darf es aus Gründen der Vernunft schon nicht geben. Das wäre auch ohne Corona so. Die Pandemie hat das nur deutlich gemacht.
Seit Mitte der 80er Jahre hat sich das Shareholder-Value-Prinzip durchgesetzt, das nur auf Profitmaximierung zielt
Leider wird es aber keine Patentrezepte geben. Wer jetzt verspricht, schnell und unkompliziert eine Lösung präsentieren zu können, ist bestenfalls ein Scharlatan, schlimmstenfalls ein übler Populist. Auf jeden Fall niemand, der unsere Probleme lösen wird.
Fraglich ist auch, ob jetzt der Zeitpunkt ist, die Systemfrage zu stellen. Der Kapitalismus lässt sich nicht durch Parlamentsbeschluss abschaffen, einmal abgesehen davon, dass derzeit niemand machbare Alternativen präsentiert.
Seit Mitte der 80er Jahre setzt sich zunehmend das Shareholder-Value-Prinzip durch, das inzwischen die Unternehmenspolitik weltweit bestimmt. Alle global agierenden großen Unternehmen verfahren danach. Ziel von Shareholder-Value ist den Wert eines Unternehmens langfristig zu Maximieren und die Eigenkapitalrendite zu erhöhen. Es kommt also auf die Interessen der Eigentümer bzw. der Anteilseigner (englisch „Shareholder“) an.
Das Prinzip war insoweit äußerst erfolgreich, als etwa die jährlichen Renditen bei Investition in ein DAX-Unternehmen sich seit den 80er Jahren vervielfacht habe. Shareholder haben eine Weile also tatsächlich schon fast unanständig profitiert.
Der Webfehler des Shareholder-Value-Prinzips liegt darin, dass es die Interessen aller anderen schlicht ignoriert, die ebenfalls vom fraglichen Unternehmen in irgendeiner Weise betroffen sind. Das sind insbesondere die Beschäftigten. Darüber hinaus können Unternehmen aber im sozialökonomischen Kontext betrachtet werden, was die Anzahl derjenigen, deren Interessen durch das Unternehmen betroffen sind, massiv erhöht. Betroffen ist im Grunde jeder, der aktiv oder passiv, mittelbar oder unmittelbar der Wertschöpfungskette des Unternehmens ausgesetzt ist.
Shareholder-Value ignoriert alle Interessen außer die der Anteilseigner
Selbst unter überzeugten Anhängern einer kapitalistischen Welt finden sich mehr und mehr Menschen, die angesichts der globalen Herausforderungen fordern, die Wirtschafts- und Sozialsysteme komplett auf neue Grundlagen zu stellen. Unternehmen sollen nicht mehr nur auf Profitmaximierung bei den Shareholdern ausgerichtet werden, sondern in ihre Unternehmenspolitik die Interessen aller „Stakeholder“ (englisch für „Interessengruppen“) mit einbeziehen.
Gemeint sind neben Anteilseignern und Beschäftigten auch Händler, Zulieferer und Kunden sowie Gewerkschaften, Umweltverbände, Parteien u.s.w.
Die Anhänger des Stakeholder-Kapitalismus versprechen sich durch eine Neuausrichtung der kapitalistischen Produktionsweise, dass soziale und ökologische Verantwortung in das System der Marktwirtschaft gleichsam eingebunden wird. Freilich liegt es den Anhängern eines freien Unternehmertums fern, dass Unternehmenspolitik gesetzlich reguliert wird. Ihnen geht es wohl mehr um einen Apell an die Vernunft der Handelnden. Ihr erklärtes Ziel ist auch nicht, den Kapitalismus zu überwinden, sondern ihn nachhaltig zu machen.
Kaum waren die Großbanken zu Lasten der Steuerzahler saniert, wurde weiter gemacht, als hätte es nie eine Krise gegeben.
Indessen ist mehr als fraglich, ob Manager von Großunternehmen sich zu mehr Reaktionen auf einen solchen Apell hinreißen lassen als zu Kopfnicken oder Achselzucken. Bereits während der großen Finanzkrise 2008 war selbst die Lobby der Shareholder auf der Weltwirtschaftskonferenz in Davos zu der Auffassung gekommen, dass Streben nach Gewinn nicht das Hauptziel eines Unternehmens sein kann. Schon damals war von „Stakeholdern“ die Rede und der Notwendigkeit, sie in Entscheidungsprozesse einzubeziehen.
Doch kaum waren die Großbanken zu Lasten der Steuerzahler saniert, wurde weiter gemacht, als hätte es nie eine Krise gegeben. Business as usual. Alles geht seinen kapitalistischen Gang.
Die Erfahrung zeigt, dass sich nur dann etwas ändern kann, wenn der Gesetzgeber aktiv wird. Das war hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter so und auch, was die Diskriminierung von Minderheiten angeht. Beispiele gibt es viele. Auch Gegenbeispiele: ohne die Deregulierung der Finanzmärkte in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hätte es die Finanzkrise 2008 jedenfalls in dem Ausmaß nicht gegeben.
Der Gesetzgeber muss also Voraussetzungen dafür schaffen, dass Stakeholder maßgeblichen Einfluss auf Entscheidungsprozesse bekommen.
Die Gewerkschaften als einer der wichtigsten Stakeholder des Arbeitsmarktes haben kaum Einfluss auf die Ziele der Großunternehmen
Die Rechte der Gewerkschaften, auf die Politik eines Unternehmens in ihren Zuständigkeitsbereichen Einfluss zu nehmen, sind arg begrenzt. Ihre Rechte beschränken sich im Wesentlichen darauf
- eine Betriebsratswahl zu initiieren,
- an Betriebsratssitzungen und Betriebsversammlungen beratend teilzunehmen sowie
- die Einhaltung der betriebsverfassungsrechtlichen Ordnung zu überwachen.
Voraussetzung ist zudem auch noch, dass im Betrieb zumindest ein Mitglied der Gewerkschaft beschäftigt ist.
Ohne Mitglieder darf die Gewerkschaft nur um solche im Betrieb werben, wenn auch höchstens zweimal im Jahr und das auch nur vor oder nach der Arbeit oder während der Pausen.
Die Gewerkschaften sind somit weit davon entfernt, bei der Unternehmenspolitik mitzureden. Sie haben nicht einmal einen vergleichbaren Einfluss wie die Betriebsräte. Zwar gibt es in etlichen Betrieben gewerkschaftliche Vertrauensleute. Deren Rechte sind indessen arg eingeschränkt. Im Grunde gibt es gar keine gesetzlichen Regeln, die sie schützen. Insbesondere gibt es keinen Sonderkündigungsschutz. Und auch keinen wirklichen Schutz dagegen, dass der Arbeitgeber oder andere ihre Arbeit behindern. Auch gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung für gewerkschaftliche Tätigkeit im Betrieb.
Der Einfluss der Gewerkschaften auf die Betriebsräte nimmt ab
Einen gewissen, wenn auch sehr begrenzten Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben die Gewerkschaften durch die Zusammenarbeit mit den Betriebsräten. Die betriebliche Mitbestimmung betrifft aber die wirtschaftliche Ausrichtung eines Unternehmens gar nicht. Und bei der Unternehmensmitbestimmung sind die Arbeitnehmervertreter stets unterlegen. Selbst dort, wo nach dem Mitbestimmungsgesetz im Aufsichtsrat Parität zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern vorgeschrieben ist, entscheidet im Zweifel der Vorsitzende und der kommt immer von der Arbeitgeberseite.
Der Einfluss der Gewerkschaften auf die Betriebsräte darf auch nicht überschätzt werden. Letztere sind den Gewerkschaften nicht untergeordnet und führen zunehmend ein „Eigenleben“. Auch ist die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft nicht Voraussetzung dafür, sich in den Betriebsrat wählen zu lassen. Immer häufiger werden Mehrheiten von sogenannten „unabhängigen Listen“ gestellt, deren Nähe zur Arbeitgeberseite oft nicht zu übersehen ist.
Knüpft man an die Vorschläge derjenigen an, die einen Stakeholder-Kapitalismus für eine Möglichkeit halten, existentiellen Problemen wie Klimakatastrophe oder Weltwirtschaftskrisen zu begegnen, haben in Deutschland die Gewerkschaften einen viel zu geringen Einfluss auf die Politik der Unternehmen, die sich in ihrem Zuständigkeitsbereich tummeln.
Der Ansatz des Stakeholder-Value macht nur Sinn, wenn man von rechtlichen Zuordnungen absieht und stattdessen auf die tatsächliche Betroffenheit durch das Handeln einzelner Unternehmen abstellt.
Stehen zwei Grundrechte im Widerstreit, muss ein Ausgleich im Wege der praktischen Konkordanz geschaffen werden
Jetzt wird man freilich nicht zu Unrecht einwenden, dass das mit Blick auf die unternehmerische Freiheit und den Eigentumsrechten verfassungsrechtlich problematisch sei. Andererseits ist auch kaum einzusehen, dass gewerkschaftliches Handeln dadurch erheblich eingeschränkt wird, dass man den Gewerkschaften nur bedingt den Zugang zu Betrieben erlaubt und ihr Mitspracherecht in wirtschaftlichen Angelegenheiten gleich Null ist.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in einer Entscheidung vom Juli 2020 betont, dass Arbeitgeber aufgrund mittelbarer Drittwirkung von Grundrechten verpflichtet sein können, Eingriffe in grundrechtlich geschützte Freiheiten durch gewerkschaftliches Handeln zu dulden. Denn arbeitsrechtlich könne jedenfalls davon ausgegangen werden, dass sich ein Arbeitgeber gegenüber einer tariffähigen Gewerkschaft in einer Position der strukturellen Überlegenheit befände.
Das Grundrecht aus Artikel 9 Absatz 3 GG schützt die individuelle Freiheit, Vereinigungen zur Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu bilden und diesen Zweck gemeinsam zu verfolgen. Geschützt ist damit auch das Recht der Vereinigungen selbst, durch spezifisch koalitionsmäßige Betätigung die in Art. 9 Abs. 3 GG genannten Zwecke zu verfolgen. Das alles ist gefestigte Rechtsprechung.
Geht es also um gewerkschaftliches Handeln, um koalitionsmäßige Betätigung und den Zwecken, die im Grundgesetz genannt sind, steht den Grundrechten der Unternehmer ein gleichberechtigtes Grundrecht der Gewerkschaften gegenüber. Befinden sich zwei Grundrechte im Widerstreit, müssten beide nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG „mit dem Ziel der Optimierung“ zu einem angemessenen Ausgleich gebracht werden. Dabei käme dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besondere Bedeutung zu. Wichtig dabei sei auch, dass die Grundrechte in ihrer Substanz nicht angetastet würden. Das nennt die Rechtswissenschaft „praktische Konkordanz“.
Gewerkschaftliches Handeln auf den Abschluss von Tarifverträgen zu beschränken greift zu kurz
Die Frage ist, ob das Grundrecht der Koalitionsfreiheit auch ein Grundrecht der Gewerkschaften auf Mitsprache bei unternehmerischem Handeln umschließt.
Artikel 9 Absatz 3 GG nennt den Zweck der Koalitionsfreiheit: es geht um die Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Das BVerfG hat bereits im Juni 1991 in der „Aussperrungs-Entscheidung“ erklärt, dass genau darin der Zweck der Gewerkschaften besteht und dass auch der Einsatz bestimmter Mittel vom Schutz des Grundrechts umfasst wird, insoweit die Verfolgung des Koalitionszwecks von diesen Mitteln abhängt.
Allerdings ging es in den Entscheidungen um Arbeitskämpfe. Sowohl das BAG als auch das BVerfG sind der Auffassung, dass Arbeitskämpfe dann erlaubt sind, wenn sie zur Erreichung rechtmäßiger Kampfziele und des nachfolgenden Arbeitsfriedens geeignet und sachlich erforderlich sind. Um rechtmäßige Kampfziele handelt es sich gemäß der Rechtsprechung des BAG dann, wenn es um ein tarifvertraglich regelbares Ziel geht.
Politische Streiks sind zwar nicht ausdrücklich durch Gesetz verboten. Sie werden aber in der Rechtsprechung als nicht legal angesehen. Diese Beschränkung des Streikrechts durch die Rechtsprechung stellt nach Auffassung des BVerfG keinen Verstoß gegen die grundgesetzlich geschützte Koalitionsfreiheit dar.
Das Grundgesetz sieht keine Beschränkung auf das konkrete Arbeitsverhältnis und Tarifvertragsbezogenheit vor. Zu den Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zählen schließlich auch gesetzliche Regeln. In Nr. 82 des Berichts des Regierungsausschusses der Europäischen Sozialcharta (ESC XIII-4) an das Ministerkomitee des Europarats werden denn auch Bedenken geäußert, ob die Beschränkung der Streikziele auf tarifvertraglich regelbare Ziele der Charta entspricht.
In anderen Ländern der westlichen Welt haben die Gewerkschaften mehr Einfluss
Deutschland nimmt mit dieser Beschränkung in Westeuropa auch eine Sonderstellung ein. In Frankreich etwa sind politische Streiks legal, wenn sie zum Ziel haben, das Parlament unter Druck zu setzen, wenn es über Gesetze beschließt, die die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen betreffen.
Diese Bedingungen werden nämlich nicht nur und nicht einmal hauptsächlich durch Tarifverträge geregelt. Nur noch 27 Prozent der Betriebe in Deutschland sind tarifgebunden. Das hat eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) ergeben. Dabei gibt es ein starkes Gefälle zwischen West- und Ostdeutschland, das zudem in jedem Jahr stärker wird. Viele der Dienstleistungsbetriebe, die in den letzten Jahren neu entstanden sind, sind von Anfang an nicht tarifgebunden.
Die von der Verfassung vorgesehene Bedeutung der Gewerkschaften für die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen nimmt leider parallel zur Tarifbindung ab. Zunehmend werden diese Bedingungen bestimmt durch betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten, die sich aus dem Shareholder-Value ergeben.
Ein Lösungsansatz könnte sein, den Gewerkschaften erheblich mehr Rechte bei der Unternehmensmitbestimmung und im Betriebsverfassungsrecht einzuräumen. Zudem müsste die nur durch Richterrecht bestimmte Beschränkung der Gewerkschaften auf durch Tarifvertrag regelbare Ziele beim Arbeitskampf aufgegeben werden. Auch insoweit könnte der Gesetzgeber aktiv werden.











